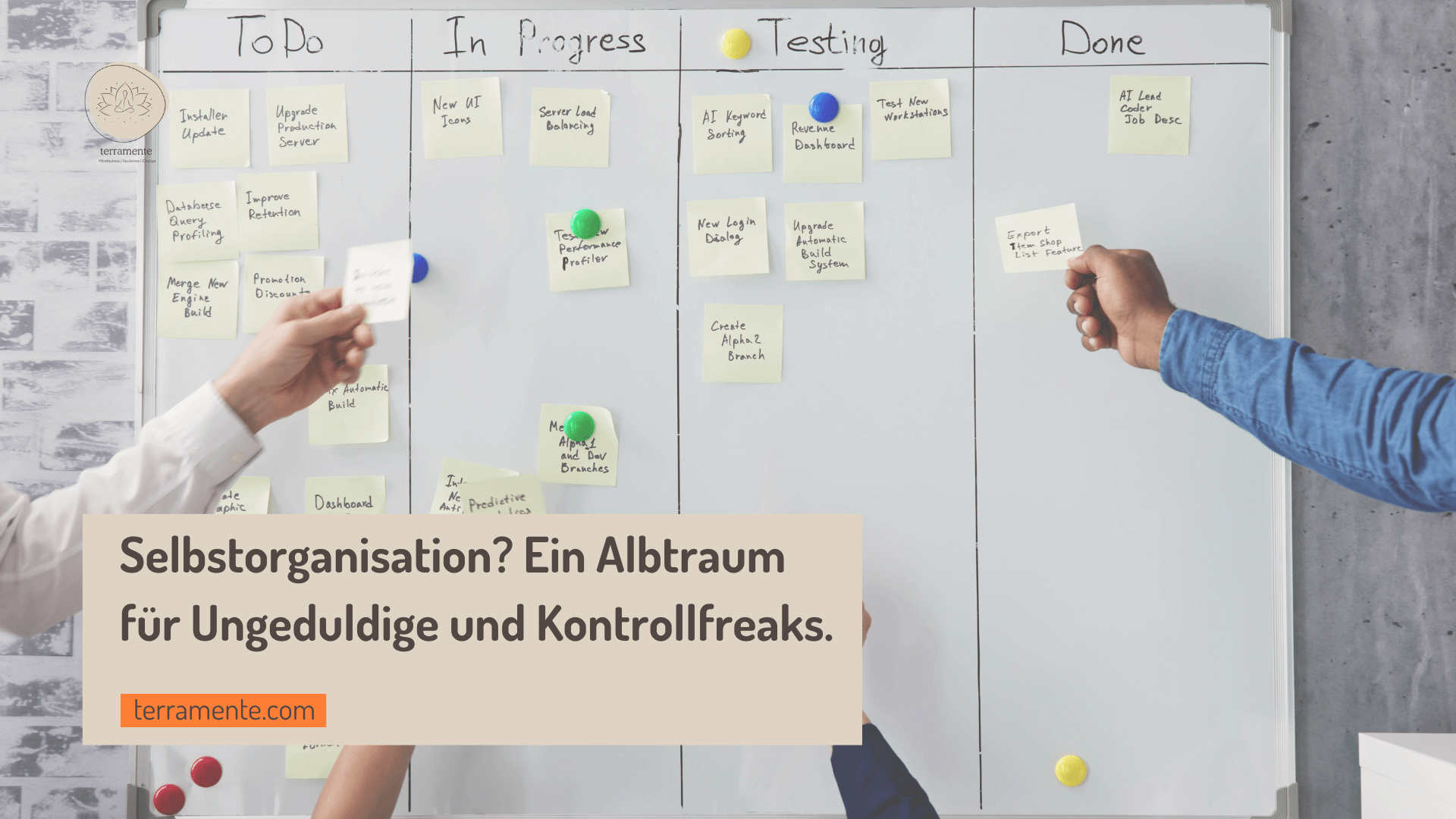Selbstorganisation? Ein Albtraum für Ungeduldige und Kontrollfreaks.
Stell dir vor, du sitzt in einer Weiterbildung zu Organisationsentwicklung und das Thema des Tages ist Selbstorganisation. Klingt spannend, oder? Freiheit, Eigenverantwortung, effiziente Teams – das große Versprechen der modernen Arbeitswelt. Und jetzt stell dir vor, du sitzt da und wartest. Und wartest. Weil die Entscheidung im Kreis zum hundersten Mal diskutiert wird, weil jede:r noch eine Meinung, noch einen Einwand hat.
Genau das habe ich erlebt. In meiner Weiterbildung zum MBSC Berater des MLI haben wir Selbstorganisation simuliert. Anfangs fand ich es noch interessant, weil so viele verschiedene Perspektiven eingebracht wurden. Doch nach der zwanzigsten Schleife um dieselbe Frage begann meine innere Stimme zu schreien: „Macht endlich jemand den verdammten Punkt?!“ Ich wollte aufspringen und rausrennen. Frust, Wut, vor allem aber Ungeduld kamen hoch.
Als dieser entsetzliche Tag vorbei war, wollte ich abreisen – tat es aber dann doch nicht. Rückblickend war aber lag in diesem Tag aber einer meiner grössten Lektionen, die diese Ausbildung mir beschert hat: Selbstorganisation ist nicht einfach nur Arbeit ohne Chef. Sie kann chaotisch sein und langwierig. Vor allem aber ist sie eine Challenge für deine Nerven, deine Geduld und dein Ego.
Die bittere Wahrheit über Selbstorganisation
Selbstorganisation klingt nach einer Revolution: Teams ohne klassische Hierarchien, maximale Freiheit, Eigenverantwortung pur. Doch hier kommt der Haken: Ohne Struktur wird sie zum nervenaufreibenden Chaos. Warum?
- Endlose Diskussionen: Wenn keiner entscheidet, drehen sich Teams stundenlang im Kreis. Entscheidungen zu treffen, ist eine Kompetenz, die viele erst lernen müssen.
- Versteckte Hierarchien: Offiziell gibt es keine Chefs mehr? Dann dominieren eben die Lautesten. Wer sich nicht aktiv einbringt, verliert.
- Ungeduld & Kontrollverlust: Wer gewohnt ist, klare Anweisungen zu geben oder schnell Ergebnisse zu sehen, bekommt hier einen Crashkurs in Frustrationstoleranz.
Manche Menschen blühen in diesem System auf, während andere am liebsten schreiend davonlaufen.
Wann Selbstorganisation klappt – und wann nicht
Perfekt für:
- Teams mit intrinsischer Motivation und hoher Eigenverantwortung.
- Branchen, in denen Kreativität und Flexibilität wichtiger sind als strikte Prozesse.
- Menschen, die Lust auf Entwicklung haben und es aushalten, dass der Weg zum Ziel auch mal holprig ist.
Hölle auf Erden für:
- Unternehmen, die nur aus einem Trend heraus Selbstorganisation einführen, ohne die Kultur mitzuverändern.
- Teams, die keine Entscheidungsmechanismen definieren.
- Kontrollfreaks, die ungeduldig werden, wenn nicht sofort Ergebnisse sichtbar sind.
Achtsamkeit & Resilienz als Erfolgsfaktoren
Selbstorganisation ist nicht nur eine Frage der Struktur, sondern vor allem eine mentale Herausforderung. Wer in alten Arbeitsweisen hängen bleibt oder Frustration nicht regulieren kann, geht unter. Doch Selbstorganisation bietet auch eine große Chance: Wer Achtsamkeit und Resilienz in den Prozess integriert, schafft Teams, die nicht nur selbstständig, sondern auch nachhaltig erfolgreich arbeiten.
Warum sind Achtsamkeit und Resilienz so wichtig?
- Selbstorganisation erfordert Selbstführung: Wer eigenverantwortlich arbeitet, muss sich selbst regulieren können. Achtsamkeit hilft, die eigenen Emotionen zu erkennen und bewusst zu agieren, anstatt impulsiv zu reagieren.
- Kollaboration statt Kampf: In selbstorganisierten Teams müssen Meinungsverschiedenheiten konstruktiv gelöst werden. Eine resiliente und achtsame Haltung hilft, den verschiedenen Perspektiven Raum zu geben und lösungsorientiert zu entscheiden.
- Balance zwischen Flexibilität und Struktur: Achtsamkeit unterstützt Teams dabei, Veränderungen zu akzeptieren und die Möglichkeiten darin zu erkennnen.
Mini-Übung: Wut-Stopp-Technik
Wenn du merkst, dass du innerlich explodierst:
- Erkennen: Spüre den ersten Anflug von Frustration oder Wut (z. B. verspannte Schultern, schnelle Atmung, Gedanken wie „Das dauert mir alles zu lange!“).
- Atmen: Drei bewusste, langsame Atemzüge nehmen.
- Pause einlegen: Innerlich „Stopp“ sagen.
- Fragen: Was ärgert mich wirklich – das Thema oder der Kontrollverlust?
- Reframe setzen: Statt „Die kriegen hier nichts auf die Reihe!“ sagen: „Selbstorganisation braucht Zeit – wie kann ich die Diskussion lenken?“
- Erst dann handeln oder sprechen. So sparst du dir unnötige Wutausbrüche und gewinnst echte Einflussmöglichkeiten.
6 Praktische Handlungsempfehlungen für Teams & Führungskräfte
1. Klare Spielregeln aufstellen: Freiheit braucht Rahmen. Definiert, wie eure Entscheidungsprozesse aussehen sollen. Wer entscheidet was? Welche Methoden helfen, zu einer Lösung zu kommen, ohne in Endlosschleifen zu geraten? Und wie wird sichergestellt, dass sich wirklich alle einbringen?
2. Rollen statt Titel definieren: Auch ohne Hierarchie braucht es Klarheit. Wer hat welche Verantwortung? Gibt es einen Moderator für Diskussionen? Von wem werden Entscheidungen und Fortschritte dokumentiert? Ohne klare Rollen werden selbstorganisierte Teams schnell ineffizient.
3. Entscheidungsformate festlegen: Nicht jede Entscheidung muss basisdemokratisch getroffen werden. Experimentiert mit Methoden wie Konsent-Entscheidungen, Delegation Poker oder der RAPID-Methode, um das Tempo hochzuhalten.
4. Emotionale Resilienz stärken: Teams, die lernen, mit Frust, Unsicherheit und Meinungsverschiedenheiten umzugehen, sind erfolgreicher. Regelmäßige Reflexion, Feedbackrunden und Techniken zur emotionalen Selbstregulation machen den Unterschied. Achtsamkeitstechniken wie gezielte Pausen, bewusste Kommunikation und Stressbewältigung helfen, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen.
5. Selbstführung trainieren: Jedes Teammitglied trägt Verantwortung für den gemeinsamen Erfolg. Reflexionsfragen wie „Was kann ich beitragen?“, „Welche Verantwortung übernehme ich?“ oder „Wie gehe ich mit Unsicherheiten um?“ fördern Selbstführung und Teamplay.
6. Regelmäßige Retrospektiven einplanen: Selbstorganisation ist ein Prozess. Was funktioniert gut? Wo gibt es Stolpersteine? Welche Routinen sollten überarbeitet werden? Teams, die sich regelmäßig Zeit zur gemeinsamen Reflexion nehmen, bleiben auf Kurs.
Die eine Frage, die sich jedes Team stellen sollte:
„Wollen wir wirklich selbstorganisiert arbeiten – oder wollen wir es nur, weil es gerade alle machen?“
Denn: Wer Selbstorganisation nur spielt, aber insgeheim doch nach einer starken Führung verlangt, wird scheitern.
Selbstorganisation klingt sexy – bis du das erste Mal mittendrin steckst. Wer’s ernst meint, braucht mehr als nur gute Absichten.
Also: Wie gehst du damit um, wenn dein selbstorganisiertes Team dich mal wieder in den Wahnsinn treibt? Lass es mich wissen!
PS: Ich kann die Weiterbildung zum Mindbased System Change Berater sehr empfehlen – gerade wegen dieser grossartigen Selbsterfahrungen. Falls du Interesse hast: https://mindlead-institut.com/angebot/lehrgaenge/berater-fuer-mindfulness-based-systems-change/